Neues Album „Rushmere“
Mumford & Sons: Rückbesinnung auf alte Tage
Sieben lange Jahre ließen die Folk-Rock-Stars Mumford & Sons nichts mehr von sich hören. Nach einer schmerzhaften Trennung im Besetzungskarussell und interner Reflexion geht das zum Trio geschrumpfte Kollektiv zurück zu den Wurzeln. Das klingt auf „Rushmere“ zwar nicht innovativ, aber eingängig und gut gemacht.
Der Zug ist in der Musikgeschichte beileibe kein neuer, aber einer, der viele Bands vor dem drohenden Exitus gerettet hat: die Rückbesinnung auf alte Werte. Ob das britische Holzfäller-Kollektiv von Mumford & Sons wirklich dem Untergang geweiht war, lässt sich vorerst nur vermuten, doch diverse Vorkommnisse vor und während der Corona-Pandemie haben zumindest heftig am einst so stabilen Fundament der Band gerüttelt. Mit ihrem Debütalbum „Sigh No More“ leiteten die guten Freunde 2009 ein Folk-Rock-Revival ein, von dem andere Acts (etwa die Lumineers) noch heute zehren. Der Nachfolger „Babel“ (2012) wurde bewusst nach dem anfänglichen Erfolgsrezept gestrickt, um den Hype weiter anzufachen. Danach schlich sich aber Routine ins Tun und man suchte nach neuen Klangufern. „Wilder Mind“ (2015) kokettierte etwas angestrengt mit elektronischen Experimenten, während man sich auf „Delta“ (2018) in eine mainstream-poppige Imagine Dragons-Nähe verstieg.
Ungemach in den eigenen Reihen
Mit der Pandemie kam die Zeit der inneren und äußeren Neukalibrierung. Nach dem ersten Schock ob der erzwungenen Live-Untätigkeit musste man sich mit unerwartetem Ungemach auseinandersetzen. Banjospieler und Gitarrist Winston Marshall verstieg sich öffentlich in rechten Parolen, entschuldigte sich später via Twitter und verließ dann später doch die Band, um seinem Weg der „freien politischen Rede“ zu folgen. Während er heute in Podcasts und TV-Sendungen die Alt-Right-Propaganda teilt, fühlt er zuweilen Reue ob seiner Entscheidung. „Ich dachte eigentlich, wir würden bis in unsere hohen 60er gemeinsam existieren“, gab er in einem Interview bekannt, „aber ich will die Diskussionen um meine Einstellung von den Jungs und ihren Familien fernhalten.“ Die Trennung verlief relativ sauber und ohne großes Säbelrasseln, die Band lag damit aber erst auf Eis. Frontmann Marc Mumford veröffentlichte 2022 sein erstes Soloalbum und offenbarte darauf seine Seele – inklusive der Beichte, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein.
Nebenbei beschlossen Mumford, Ben Lovett und Ted Dwane als Trio mit Livemusiker-Aufstockung weiterzumachen und sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen. Man feilte gemütlich an den Songs, diskutierte und argumentierte, bis man sich auf einen Weg einigte, der fast 20 Jahre zurückreicht und vielleicht eine musikalische Notwendigkeit darstellt, um die unerfreulichen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit abzuwälzen und neuen Mutes voranzuschreiten. Anfang des Jahres veröffentlichte das Trio die erste Single „Rushmere“ und ließ ihre Fans der alten Tage mit der Zunge schnalzen. Die Gitarre duelliert sich mit dem Banjo, das fröhliche „Hobo-Feeling“ steuert auf einem zeitlosen Klangschiff und die Stammgenres Folk, Rock und Indie-Pop werden so leichtfüßig vermischt, wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Innovativ ist anders, aber sichere Besen kehren gut und die Experimentierwut der letzten Jahre scheint einer Rückbesinnung mit der Liebe zur Konstanz gewichen zu sein.
Zwischen Mikro- und Makrokosmos
„Rushmere“ ist nicht nur Song- und Albumtitel, sondern auch Kernbotschaft der zehn neuen Songs. So heißt angeblich auch ein Teich im Londoner Stadtteil Wimbledon, wo sich das einstige Quartett vor 18 Jahren zusammenfand, und eine Karriere begründete, deren Erfolge einst nicht einmal in den kühnsten Träumen zu ahnen war. Auf dem dazugehörigen Albumcover sieht man die drei Kernmitglieder flankiert vom Stress des Alltags und unter einer drohend-düsteren Wolkenschicht. Man meint zu erkennen, dass es um die Lage im Mikro- und Makrokosmos der Band gerade nicht so gut bestellt ist, aber die Hoffnung darf man nie verlieren. Mit nicht einmal 35 Minuten Spielzeit geht „Rushmere“ nach sieben Jahren ohne Album erstaunlich schnell über die Ziellinie, aber viel mehr braucht es auch nicht, wenn das Wesentliche gesagt wird. Im Großen und Ganzen ist das eine Vermischung aus sanfter Folklore, leicht austreibenden Momenten und einer textlichen Auseinandersetzung, die sich auch mit der zunehmenden Verrohung der Menschheit befasst.
Im Opener „Malibu“ zupft eine Akustikgitarre, während Mumford „no more doubt, no more weakness“ singt und mit einer motivierenden Ansprache in das Werk leitet. Schnelle Ausschlenker wie etwa bei „Caroline“ oder dem lebensbejahenden „Truth“ sind aber eher die Seltenheit, das Trio fühlt sich in Moll und Mid-Tempo deutlich wohler. „Monochrome“ ist eine entspannte Lagerfeuerballade mit Sinn für Ästhetik, während „Where It Belongs“ nur aus Mumfords zartem Timbre, Akustikgitarre und Piano besteht – inhaltlich ist der Song ein Mahnmal für Kommunikation und gegen die zunehmende Spaltung. Zwischen weltlicher und persönlicher Gefühlslage mäandert auch das gelungene „Anchor“, in dem Mumford „let your anger go to hell, where it belongs“ singt und im Schlussdrittel von seiner Band verstärkt wird. Übrigens, „Truth“ – darin besinnt sich der Brite auf seine frühen Geburtsmonate in Kalifornien. Die Rückbesinnung herrscht auch auf persönlicher Ebene.
Überschaubares Pathos
„Rushmere“ vereint nicht nur die klassischen Tugenden der frühen Mumford & Sons, sondern schafft es auch, mit dem Fokus auf bandinterner Gemeinschaft die weltlichen Probleme so anzugreifen, dass das unvermeidliche Pathos überschaubar bleibt. Natürlich kann man die vorsichtige Sicherheitsstruktur im Songwriting bekritteln und sich darüber mokieren, dass man den Studioaufenthalt in Nashville nicht dazu nutzte, ein bisschen stärker aufs Gaspedal zu steigen und sich nicht so extrem in der musikalischen Langsamkeit zu suhlen. Als Zeitdokument und im Gesamtkontext funktioniert der bewusste Schritt in eine altbekannte und sichere Schiene aber besser, als würde man sich, wie bei den letzten beiden Alben, wieder dazu verleiten lassen, einem Trend zu folgen, der zulasten der bandinternen Authentizität geht. Ein Österreich-Livetermin ist noch ausständig – aber für das vierte Quartal 2025 oder im nächsten Jahr sicher nicht unrealistisch.






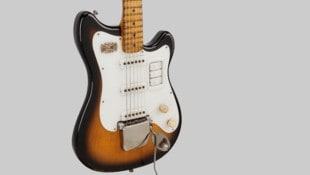















Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.